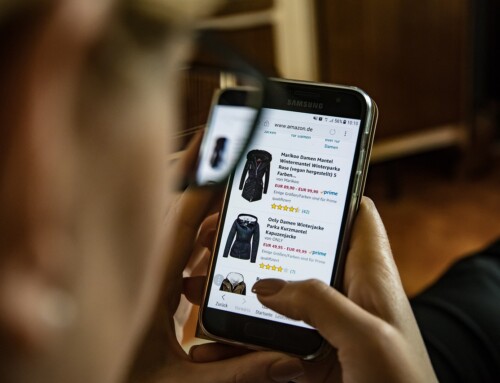Ob ein Softwareentwicklungsvertrag als Werkvertrag oder als Dienstvertrag einzustufen ist, hat erhebliche Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Vertragspartner. Während ein Werkvertrag einen konkreten Erfolg schuldet, wird beim Dienstvertrag lediglich die Arbeitsleistung als solche geschuldet, unabhängig vom Ergebnis. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat sich in seinem Urteil vom 19. Dezember 2024 (Az. 10 U 201/22) erneut mit dieser Frage auseinandergesetzt und sich dabei mit einem IT-Projekt befasst, bei dem ein Dienstleister Software-Schnittstellen entwickeln sollte.
Der Fall: Streit um Vergütung und mangelhafte Softwareleistungen
In dem entschiedenen Fall hatte ein IT-Dienstleister mit einem Personalberatungsunternehmen, das ebenfalls in der IT-Branche tätig war, einen sogenannten Subunternehmervertrag geschlossen. Der Auftrag bestand in der Entwicklung zweier Software-Schnittstellen – einer für die Q Holding GmbH und einer für die Y-Solutions AG. Der Vertrag hatte eine feste Laufzeit von 180 Tagen und sah eine Vergütung auf Stundenbasis vor: 110 Euro pro Stunde für Arbeiten vor Ort und 100 Euro pro Stunde für Tätigkeiten im Homeoffice.
Nach Abschluss des Projekts kam es zum Streit über die Abrechnung. Der IT-Dienstleister forderte die Vergütung für geleistete 69,5 Stunden, während der Auftraggeber sich weigerte zu zahlen. Zudem verlangte der Auftraggeber die Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen für frühere Tätigkeiten mit der Begründung, die Software sei entweder nicht geliefert oder völlig unbrauchbar gewesen. Daraus ergab sich die zentrale juristische Frage: War der IT-Dienstleister verpflichtet, ein funktionsfähiges Produkt zu liefern, oder hatte er lediglich seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen?
Warum das OLG Frankfurt den Vertrag als Dienstvertrag einstufte
Das OLG Frankfurt kam zu dem Ergebnis, dass der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag als Dienstvertrag und nicht als Werkvertrag zu qualifizieren ist. Maßgeblich für diese Einordnung waren mehrere Faktoren.
Ein entscheidendes Indiz war die vereinbarte Vergütung auf Stundenbasis. Anders als im Werkvertragsrecht, in dem die Zahlung üblicherweise erst nach erfolgreicher Fertigstellung und Abnahme des Werks erfolgt, war hier die Vergütung allein an die geleistete Arbeitszeit geknüpft. Das spricht deutlich für einen Dienstvertrag, da dieser keine Erfolgshaftung vorsieht. Auch die Vertragslaufzeit war ein weiteres Argument für diese Einordnung. Der Vertrag war auf 180 Tage befristet, ohne dass eine konkrete Fertigstellung eines bestimmten Produkts als Voraussetzung für die Vergütung definiert war.
Zudem enthielt der Vertrag mehrfach den Begriff „Dienstleistungen“, was darauf hindeutet, dass sich die Parteien bewusst für eine Vertragsform entschieden hatten, die keine Erfolgsgarantie beinhaltete. Die Vertragsklauseln gaben dem Auftraggeber außerdem die Möglichkeit, den genauen Leistungsumfang während der Vertragslaufzeit anzupassen, was ebenfalls eher für eine dienstvertragliche Struktur spricht. Wäre ein bestimmtes Endprodukt geschuldet gewesen, hätte die genaue Leistungspflicht bereits zu Beginn klar definiert sein müssen.
Ein weiteres starkes Indiz für den Dienstvertragscharakter war die fehlende Abnahmeregelung. Im Werkvertragsrecht ist die Vergütung regelmäßig erst nach einer förmlichen Abnahme des Werks durch den Auftraggeber fällig. Hier hingegen gab es eine solche Regelung nicht. Die Zahlung war nicht von einer Abnahme oder Funktionsprüfung der Software abhängig, sondern wurde nach erbrachten und bestätigten Stunden abgerechnet.
Welche Konsequenzen hat das Urteil für IT-Dienstleister und Auftraggeber?
Diese Entscheidung des OLG Frankfurt verdeutlicht, dass IT-Verträge in ihrer rechtlichen Gestaltung erhebliche Auswirkungen auf die Rechte der Vertragsparteien haben. Unternehmen, die Softwareentwicklungsleistungen beauftragen oder erbringen, sollten sich der Unterschiede zwischen Werk- und Dienstvertrag bewusst sein.
Soll ein bestimmtes Arbeitsergebnis geschuldet sein – wie eine funktionsfähige Software oder eine einsatzbereite Schnittstelle –, muss dies ausdrücklich im Vertrag geregelt werden. Fehlt eine solche Regelung und wird die Vergütung nach Zeitaufwand berechnet, spricht dies stark für einen Dienstvertrag. Entscheidend ist jedoch die Gesamtbewertung des Vertragsinhalts. Wenn der Auftragnehmer lediglich eine Tätigkeit schuldet und keine Erfolgsgarantie übernimmt, liegt in der Regel ein Dienstvertrag vor. Wird hingegen ein bestimmtes, einsatzfähiges Arbeitsergebnis geschuldet, kann trotz Stundenabrechnung ein Werkvertrag anzunehmen sein.
Für Auftraggeber bedeutet das, dass sie bei Dienstverträgen grundsätzlich nicht ohne Weiteres Zahlungen zurückfordern können, wenn das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wurde. Nur wenn eine nachweisbare Pflichtverletzung des Dienstleisters vorliegt – etwa eine völlig unbrauchbare oder fehlerhafte Leistung –, kann ein Schadensersatzanspruch in Betracht kommen. Ein bloßes Ausbleiben des Erfolgs reicht hingegen nicht aus, um eine Rückzahlung zu verlangen.
Fazit: Klare Vertragsgestaltung ist entscheidend
Die Abgrenzung zwischen Werk- und Dienstvertrag ist für IT-Projekte von zentraler Bedeutung. Wer sicherstellen will, dass ein bestimmter Erfolg geschuldet ist, muss dies unmissverständlich im Vertrag festhalten. Auftraggeber sollten besonders auf die Vergütungsstruktur und die Definition der Leistungspflichten achten. Eine erfolgsabhängige Zahlung spricht für einen Werkvertrag, während eine Abrechnung nach Stunden ein starkes Indiz für einen Dienstvertrag ist.
Unsere Kanzlei unterstützt Unternehmen bei der rechtssicheren Gestaltung und Prüfung ihrer IT-Verträge. Ob als Auftraggeber oder als Dienstleister – mit einer klaren Vertragsstruktur lassen sich spätere Streitigkeiten vermeiden und wirtschaftliche Risiken minimieren. Lassen Sie sich beraten, bevor Sie einen Vertrag abschließen – damit Ihre Projekte auf einer soliden rechtlichen Grundlage stehen.