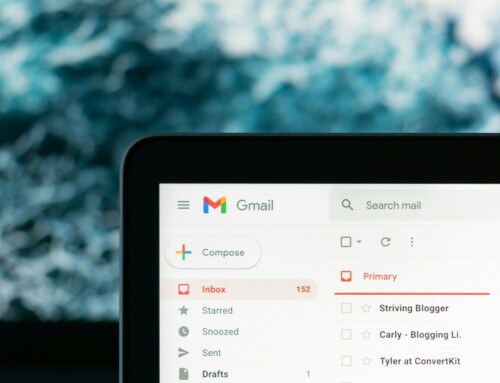Wer sich gegen die Verletzung seiner Privatsphäre zur Wehr setzt, steht vor einem juristischen Dilemma: Einerseits soll der Rechtsschutz effektiv und schnell erfolgen – insbesondere im Wege der einstweiligen Verfügung. Andererseits verlangt die Zivilprozessordnung grundsätzlich die Angabe einer ladungsfähigen Anschrift. Doch was geschieht, wenn genau diese Angabe den Schutz der Privatsphäre weiter gefährden würde? Das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 14. Januar 2025 (Az. 27 O 322/24) eine bemerkenswerte Antwort gegeben – mit erheblichen Folgen für die Praxis des Medien- und Persönlichkeitsrechtsschutzes.
Verfahren gegen die Presse ohne Wohnadresse – geht das überhaupt?
Im Mittelpunkt des Falls standen zwei Antragsteller: Ein prominenter Fernsehmoderator und seine nicht-öffentliche Lebensgefährtin. Ein Boulevardmedium hatte über ihre angebliche Beziehung berichtet – mit Fotos und persönlichen Details. Die Betroffenen wehrten sich mittels einstweiliger Verfügung gegen diese Berichterstattung. Bemerkenswert: Der Moderator gab im Antrag nicht seine Wohnanschrift, sondern eine c/o-Anschrift an. Seine Lebensgefährtin blieb ebenfalls anonymisiert. Das Ziel war klar: die eigene Privatadresse aus dem Verfahren herauszuhalten – aus Sorge vor weiteren Recherchen oder gar Stalking.
Zentraler juristischer Streitpunkt war also nicht nur die Frage, ob ein Unterlassungsanspruch bestand, sondern ob der Antrag ohne Wohnanschrift überhaupt zulässig war. § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO verlangt grundsätzlich die Angabe der „Parteien und ihrer gesetzlichen Vertreter“ einschließlich einer ladungsfähigen Anschrift – ein scheinbar formaler Punkt, der bei näherem Hinsehen aber verfassungsrechtlich aufgeladen ist.
Rechtsschutz trotz Geheimhaltung – das Schutzinteresse als Korrektiv
Das Landgericht Berlin stellt sich ausdrücklich auf die Seite der Persönlichkeitsrechte. Es hält den Antrag auch ohne Angabe der Wohnadresse für zulässig, wenn schutzwürdige Gründe für die Geheimhaltung vorliegen. Die Anforderungen an die Angabe der Anschrift dürfen nicht weiter gehen, als es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Gegners und für den ordnungsgemäßen Verfahrensablauf erforderlich ist. Es geht also um eine Abwägung – zwischen dem berechtigten Geheimhaltungsinteresse der Betroffenen und dem Bedürfnis nach einer verfahrensrechtlich sauberen Antragstellung.
Das Gericht führt weiter aus, dass die Funktion der Adressangabe – Identifikation, persönliche Ladung, Zustellung – auch durch eine c/o-Adresse erfüllt werden kann, sofern der Antragsteller dort mit gewisser Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Eine gewisse Kontaktmöglichkeit genüge; eine ständige persönliche Anwesenheit sei nicht erforderlich. Nur wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestünden, dass der Antragsteller unter dieser Adresse nie erreichbar sei oder sich später etwa seiner Kostentragungspflicht entziehen wolle, könne das Geheimhaltungsinteresse zurücktreten.
Pressefreiheit versus Privatsphäre – keine Pauschalantwort möglich
Das Urteil des LG Berlin reiht sich in eine Linie von Entscheidungen ein, die dem Schutz der Privatsphäre auch im gerichtlichen Verfahren Vorrang einräumen, sofern die praktischen Erfordernisse des Verfahrens erfüllt sind. Besonders relevant ist das für Verfahren im Medienrecht, wo die Antragsteller oftmals gerade wegen zu viel Öffentlichkeit den Weg zu Gericht suchen. Es wäre widersinnig, wenn sie dort gezwungen würden, gerade jene Informationen preiszugeben, deren Schutz sie begehren – etwa ihre Wohnadresse. Damit würde der Zweck des Rechtsschutzes konterkariert.
Die Entscheidung greift auf bewährte Argumente aus der Rechtsprechung des BGH zurück (vgl. etwa BGH GRUR 2018, 1181 – Anschrift des Klägers), wonach eine alternative ladungsfähige Anschrift ausreicht, wenn die Interessen beider Seiten gewahrt bleiben. Das Gericht betont, dass es nicht auf die Häufigkeit der Anwesenheit an der c/o-Adresse ankommt – entscheidend sei allein die praktische Möglichkeit einer Zustellung. Damit ist auch klargestellt: Die Kanzleianschrift eines Rechtsanwalts, unter der der Mandant zumindest gelegentlich erreichbar ist, kann genügen.
Einzelfallprüfung bleibt zwingend – Rechtsmissbrauch ausgeschlossen
Die praktische Relevanz dieser Entscheidung ist hoch. Besonders in Fällen, in denen journalistische Recherchen aggressiv betrieben oder persönliche Daten aus Prozessen heraus zweckentfremdet werden, stellt die Angabe der Wohnanschrift ein zusätzliches Risiko dar. Dieses Risiko muss in die prozessuale Abwägung einbezogen werden. Die Justiz darf nicht zum Erfüllungsgehilfen für weitere Persönlichkeitsrechtsverletzungen werden.
Gleichzeitig schützt das Urteil vor Missbrauch: Wer versucht, sich durch die Geheimhaltung der Wohnadresse einem möglichen Kostenrisiko zu entziehen oder unauffindbar zu machen, kann sich nicht auf ein berechtigtes Interesse berufen. Ebenso wenig darf durch die Geheimhaltung der Eindruck entstehen, ein Antragsteller führe seinen Prozess „aus dem Verborgenen“, ohne identifizierbar zu sein.
Prominente Antragsteller besonders betroffen – Schutz durch Agenturen oder Kanzleien
Für Unternehmen, Agenturen und prominente Persönlichkeiten eröffnet das Urteil praxisnahe Handlungsspielräume. Die Angabe einer c/o-Adresse bei einer Agentur oder bei der beauftragten Kanzlei kann ausreichen, um wirksamen Rechtsschutz zu erlangen – ohne die eigene Adresse preiszugeben. Voraussetzung ist lediglich, dass der Betroffene dort „mit gewisser Wahrscheinlichkeit“ erreichbar ist. Zustellungen an den anwaltlichen Vertreter sind ohnehin zulässig, sodass der Verfahrensablauf nicht gestört wird.
Besonders bedeutsam ist dies für Prominente, die regelmäßig Zielscheibe medialer Berichterstattung sind. Eine Offenlegung ihrer Wohnanschrift würde nicht nur ihre Privatsphäre verletzen, sondern potenziell auch zu Belästigungen oder Bedrohungen führen – eine reale Gefahr in Zeiten digitaler Eskalation.
Fazit: Mehr Schutz für redliche Antragsteller
Die Entscheidung des LG Berlin schafft einen ausgewogenen Ausgleich. Einerseits bleibt das Verfahren rechtsstaatlich fundiert, die Identifizierbarkeit und Erreichbarkeit der Parteien gewahrt. Andererseits erhalten Antragsteller, die sich gegen mediale Übergriffe wehren, ein effektives Instrument zum Schutz ihrer Privatsphäre – ohne sich durch die Offenlegung ihrer Wohnanschrift neuen Risiken auszusetzen. Dafür muss ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse bestehen und es liegen keine Anhaltspunkte für Rechtsmissbrauch vor.
Für Unternehmen, Medienschaffende und Vertreter prominenter Persönlichkeiten ist das ein wichtiges Signal. Der Zugang zum einstweiligen Rechtsschutz bleibt auch dann offen, wenn die Offenlegung der eigenen Adresse mit erheblichen Risiken verbunden wäre.